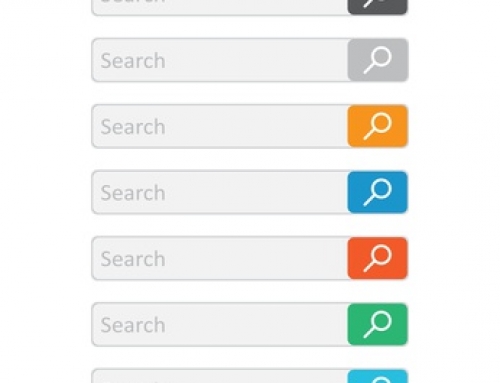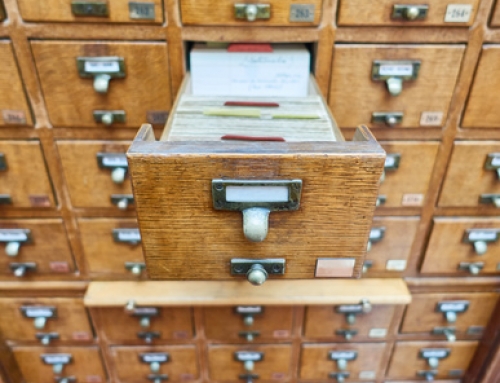Von Dr. Korbinian Weigl
Seit In-Kraft-Treten der EU-Verordnung 2021/2282 am 11. Januar 2022 gibt es eine rechtliche Grundlage für die gemeinsame klinische Bewertung (Joint Clinical Assessments, JCA) von Gesundheitstechnologien (Health Technology Assessment, HTA) auf Ebene der Europäischen Union (EU). Seit 12. Januar 2025 unterliegen damit Medikamente für onkologische Erkrankungen sowie Arzneimittel für neuartige Therapien der JCA. Bis 2030 werden schrittweise sämtliche Arzneimittel, für die eine zentrale Zulassung durch die Europäische Kommission auf EU-Ebene beantragt wurde, die JCA durchlaufen.
Wichtig dabei: die JCA auf Ebene der EU ersetzt nicht die frühe Nutzenbewertung im nationalen Kontext nach §35a SGB V. Vielmehr soll eine Verzahnung der Bewertungen stattfinden. Das ist zweifellos eine Herausforderung, nicht nur für die betroffenen pharmazeutischen Unternehmer (pU), sondern auch für die an der Bewertung beteiligten nationalen und internationalen HTA-Behörden. In Deutschland ist es die gesetzliche Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), neu zugelassene erstattungsfähige Wirkstoffe bezüglich ihres Zusatznutzens zu bewerten.
Um die für die nationale Bewertung notwendigen Vorlagen für die Beratungsanträge und die Nutzendossiers auf die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, wurden diese nun überarbeitet. Dieser Schritt wurde vom G-BA Anfang des Jahres angekündigt, wobei schon damals absehbar war, dass es keine separaten Vorlagen für rein nationale Dossiers und solchen Dossiers geben wird, die bereits die europäische klinische Bewertung durchlaufen haben.
Die geänderten Vorlagen sind auf der Homepage des G-BA einsehbar und müssen noch durch das Bundesministerium für Gesundheit genehmigt und im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.
Wichtige Änderungen
Beratungsantrag
Die Änderungen hinsichtlich des Beratungsantrags betreffen hauptsächlich die Form der Dateneinreichung. Der Hinweis auf eine DVD wurde gelöscht, da diese meist nicht mehr benutzt wurde, sondern die Anträge – wie die Dossiers auch – über das Portal des G-BA übersendet wurden. Hinzu kam auch die Anforderung, dass der Inhalt des Beratungsantrags kopierbar sein soll.
Darüber hinaus werden nun zusätzliche Informationen abgefragt, die dem besseren Verständnis zum Wirkstoff bzw. zu dessen Wirkmechanismus dienen sollen. Dazu wurde eine zusätzliche Frage in der Vorlage eingefügt. Der vom G-BA geforderten Vereinheitlichung der Gliederung der Fragen, die im Beratungsgespräch erörtert werden sollen, sind die meisten pU erfahrungsgemäß bereits in den bisherigen Beratungsanträgen nachgekommen.
Keine doppelte Einreichung von Daten – Verweislösung
Kniffliger wird es bei der Vorgabe der EU-Verordnung, dass bei einer Bewertung durch nationale HTA-Behörden keine Daten eingereicht werden sollen, die der pU bereits im Rahmen des JCA präsentiert hat. Der G-BA löst diese Anforderung mit der „Verweislösung“ und fordert die pU auf, im nationalen Dossier darzulegen, ob und welche Nachweise, die bereits im EU-Dossier bereitgestellt wurden, Grundlage der Nutzenbewertung sein sollen. Diese Änderung wird flankiert von Aussagen des G-BA in diversen Informationsveranstaltungen, dass eine doppelte Einreichung von Daten im nationalen Bewertungsprozess nicht zu einer formellen Unvollständigkeit führt. Damit gesteht der G-BA den pU eine Flexibilität beim Umgang mit Daten zu, die sowohl für die JCA als auch für die nationale Bewertung von Belang sind. Diese Verweislösung zieht sich durch die Vorlagen der Module 2, 3 und 4 und wird an den entsprechenden Stellen erwähnt.
Einschränkend ist anzumerken, dass die Verweislösung nur auf Wirkstoffe zutrifft, für die ein Bewertungsverfahren auf EU-Ebene eingeleitet wurde. Sollte das Dossier auf EU-Ebene unvollständig eingereicht worden sein oder das Verfahren eingestellt werden, ist das bisher übliche vollständige nationale Dossier beim G-BA einzureichen, ausdrücklich ohne Verweise auf das europäische Dossier. Ebenso unzulässig sind dynamische Verweise, d.h. Verweise auf künftige Nachweise, die erst zu einem späteren Zeitpunkt im Verlauf des JCA des Arzneimittels nachgereicht werden.
Ebenfalls von Bedeutung ist das Wahlrecht des pU, bei mehreren gleichermaßen zweckmäßigen Vergleichstherapien (zVT) zu wählen, welche Vergleichstherapie(n) er für den Nachweis des Zusatznutzen im Dossier heranzieht und welche nicht. Diese Wahlmöglichkeit besteht beim EU-Dossier nicht: dort ist der pU verpflichtet, sämtliche Fragestellungen zu den relativen Effekten des Arzneimittels, die sich aus dem Bewertungsumfang (sog. PICOs) ergeben, zu beantworten.
Literaturrecherchen
Nicht weiter verwunderlich ist die Klarstellung des G-BA, bei der Aktualität der Literatur- und Registerrecherchen auf den bereits vertrauten 3-Monats-Zeitraum zu pochen, unabhängig von einer eventuell bereits zuvor durchgeführten Recherche im Rahmen des EU-Dossiers. Sollten bei der aktualisierten Recherche gegenüber der Recherche vom EU-Dossier keine neueren Quellen und Daten identifiziert werden, genügt nun ein Verweis auf die Ergebnisse der Recherche des EU-Dossiers.
Inhaltliche Änderungen der Vorgaben zur bibliografischen Recherche und zur Registerrecherche müssen ebenfalls beachtet werden. Bei der bibliografischen Recherche genügt nun die Abfrage von Medline und Cochrane CENTRAL. Embase kann optional dargestellt werden, ist aber nicht mehr verpflichtend. Bei der Registerrecherche müssen nun neben ClinicalTrials.gov die alte (euclinicaltrials.eu) und die neue (Clinical Trials Information System, CTIS) EU-Datenbank durchsucht werden, sowie die Seite der Europäischen Arzneimittelagentur EMA (European Medicines Agency). Letztere muss – wie bisher auch – nicht im Anhang von Modul 4 dokumentiert werden.
Ergebnisdarstellung – Unerwünschte Nebenwirkungen
Bei der Ergebnisdarstellung in Modul 4 gibt es neben der Spezifizierung der Subgruppenanalysen bzgl. der Krankheitsschwere vor allem eine Änderung, was die Präsentation von Auswertungen der unerwünschten Ereignisse (UE) betrifft. Diese müssen nicht mehr differenziert nach Schweregrad (einschließlich einer Abgrenzung schwerer und nicht-schwerer UE) dargestellt werden. Ebenso sind a priori definierte UE von besonderem Interesse sowie prädefinierte SOC-übergreifende UE-Auswertungen nicht mehr darzustellen. Es ist lediglich die Gesamtrate schwerer UE zu präsentieren.
Formale Vorprüfung des Nutzendossiers
Vor der finalen Einreichung eines Nutzendossiers beim G-BA hat der pU die Möglichkeit auf eine formale Vorprüfung des Dossiers durch den G-BA. Diese Vorprüfung wird nun dahingehend erweitert, als das durch den G-BA nun auch geprüft wird, ob die im nationalen Dossier eingefügten Verweise auf das EU-Dossier korrekt eingepflegt wurden, und eine eindeutige Zuordnung gewährleisten. Eine inhaltliche Prüfung der Verweise in Bezug auf die Eignung der zugehörigen Nachweise für die Bewertung des Zusatznutzens wird im Rahmen der formalen Vorprüfung – wie bisher bei den Inhalten des Dossiers auch – explizit nicht vorgenommen.
Terminliche Koordinierung der Bewertungen
Verweislösung bei noch nicht veröffentlichtem EU-Dossier
Für den Fall, dass das EU-Dossier, auf das im nationalen Nutzendossier verwiesen wird, zum Zeitpunkt der Dossier-Einreichung beim G-BA noch nicht veröffentlicht ist, hat der G-BA vorgesorgt. Der pU ist dann verpflichtet, innerhalb von drei Werktagen, dem G-BA eine Fassung des EU-Dossiers zur Verfügung zu stellen, in der mindestens die Nachweise enthalten sind, die Grundlage der Nutzenbewertung sind, und in der alle aus Sicht des pU vertraulichen Informationen unkenntlich gemacht wurden. Diese Fassung wird unverzüglich auf der Internetseite des G-BA veröffentlicht. Sobald das EU-Dossier auf der dafür vorhergesehenen Plattform veröffentlich ist, entfernt der G-BA die durch den pU bereitgestellte Fassung des EU-Dossiers und pflegt einen Verweis auf das veröffentlichte EU-Dossier ein.
Veröffentlichungszeitpunkte der gemeinsamen klinischen Bewertung
Sofern die JCA erst nach der Einreichung des nationalen Nutzendossiers veröffentlicht wird, wird die Bewertung Bestandteil der Stellungnahme und wird in dessen Rahmen für die Nutzenbewertung berücksichtigt. So haben alle an der frühen Nutzenbewertung beteiligten Parteien die Möglichkeit, zu beiden Bewertungen Stellung zu beziehen.
Fazit:
Was bedeuten die Änderungen nun für die pU? Zunächst einmal muss festgehalten werden: für Arzneimittel, die noch nicht EU-Dossier-pflichtig sind, ändert sich – außer der zu verwendenden Vorlage – nicht viel. Die Anpassung der zu durchsuchenden Datenbanken ist teilweise sicherlich sinnvoll (z.B. die Abfrage von CTIS, Wegfall der WHO-Datenbank), jedoch deckt sich die nunmehr nur optionale Abfrage von Embase bei der bibliografischen Recherche bei gleichzeitiger Beibehaltung von Cochrane CENTRAL nicht mit unseren Erfahrungen der Recherche-Ergebnisse. CENTRAL wird hauptsächlich aus Medline, Embase und den Registerdatenbanken ClinicalTrials.gov und der WHO-Datenbank gespeist, sodass hier eine Verschlankung und Vereinfachung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Ergebnisqualität darin bestanden hätte, auf CENTRAL zugunsten von Embase zu verzichten.
Wie praktikabel die Verweislösung auf Daten des EU-Dossiers ist, wird sich noch herausstellen. Zunächst klingt es nach einer pragmatischen Lösung, wobei der G-BA den pU Spielräume in der Dossier-Erstellung geben möchte. Bei korrekter Anwendung kann damit unnötige Doppelarbeit vermieden werden. Inwiefern der Lesbarkeit Genüge getan wird, wenn in Zukunft zur Interpretation der Daten zwei Dossiers parallel geöffnet werden müssen, sei dahingestellt.
Nicht ganz ausgemerzt wurden leider kleine Unstimmigkeiten in den Vorlagen. So sind diverse Tabellen-Verlinkungen weiterhin nicht hinterlegt, und auch die verwendeten Schriftgrößen und Schriftabstände sind nicht durchgängig konsistent. Auch stolpert man darüber, dass in Modul 4 der Abschnitt 4.3.1.4 und die entsprechenden Äquivalenzen in den Folgeabschnitten gestrichen wurden, aber der G-BA für diese Abschnitte in Modul 5 RIS-Dateien verlangt. Aber bei der Fülle der Vorgaben und Änderungen sind derartige Inkonsistenzen zu verschmerzen.